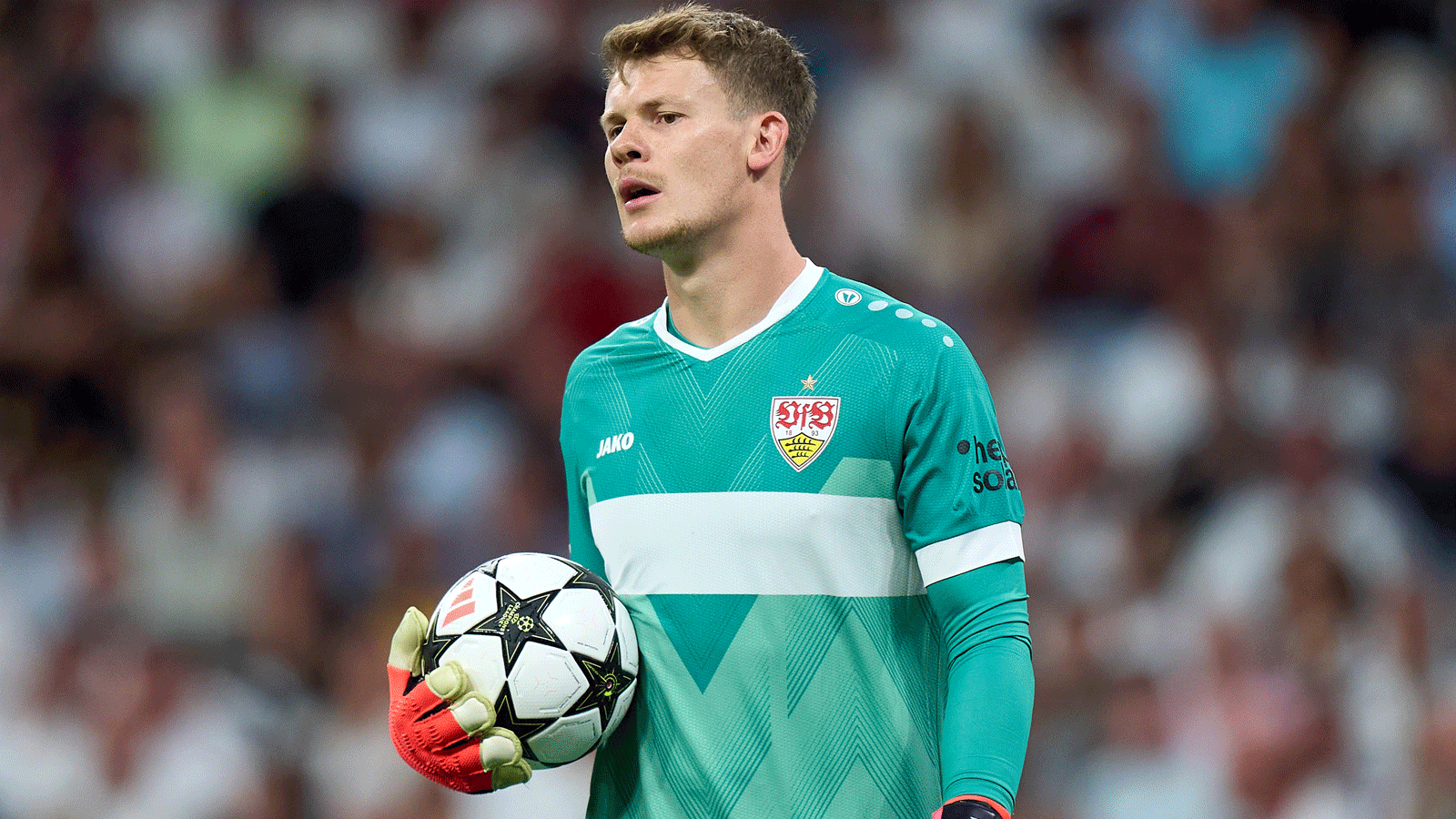Das Interview wurde im Juli 2017 zum ersten Mal veröffentlicht.
Anlässlich des zehnten Todestages von Robert Enke gibt es hier noch einmal das bemerkenswerte Interview mit Teresa Enke.
SPOX: Frau Enke, mit dem Abstand, den sie nun haben: Wie präsent ist Robert noch?
Teresa Enke: Robby ist bei mir täglich präsent, sei das durch Bilder in der Wohnung oder gemeinsame Erinnerungen. Er ist immer da und wird immer dabei sein genau wie unsere erste Tochter. Es schmerzt mich nicht mehr, an ihn zu denken.
SPOX: Das ist schön zu hören.
Enke: Es gehört einfach zu meinem Leben dazu. Natürlich werde ich auch manchmal traurig, weil er so viele Dinge einfach nicht mehr erleben konnte und die Krankheit so übermächtig war, dass er dieses trotz unserer Schicksalsschläge so schöne Leben als nicht mehr lebenswert empfunden hat. Das ist sehr schade.
SPOX: Und wie steht es um den Rest der Familie, Freunde und Bekannte von früher?
Enke: Die Erinnerung wird selbstredend nicht so stark sein wie die letzten gemeinsamen 15 Jahre von uns beiden. Die tollen Zeiten in Lissabon oder die schwierige Phase in Barcelona haben uns geprägt und zusammengeschweißt. Wenn ich mich mit Familie und Freunden treffe, sprechen wir oft über Robby, kramen sowohl lustige Geschichten aus, aber reden auch darüber, wie es so weit kommen konnte. Ich versuche immer zu vermitteln, auch wenn es vielleicht etwas platt klingt, dass jemand weiterlebt, wenn er nicht vergessen wird. Und das ist durch unsere Gespräche und alleine schon wegen der Robert-Enke-Stiftung zum Glück der Fall.
SPOX: Stichwort: "nicht vergessen". Mit der Zeit werden immer weniger Menschen etwas mit dem Namen Robert Enke anfangen können. Das ist ganz natürlich. Haben Robert und sein Fall genug Präsenz und einen ausreichenden Stellenwert in der Gesellschaft und den Medien?
Enke: Langfristig ist es ganz wichtig, dass der Bekanntheitsgrad der Stiftung über den von Robert selbst hinauswächst. Direkt im Anschluss an den Suizid waren die Präsenz des Falls und der Krankheit Depression enorm. Robert hat mit seinem Suizid ganz viele Menschen wachgerüttelt und die Krankheit enttabuisiert und entstigmatisiert. Dass das langfristig so blieb, war auch ein Verdienst der Stiftung. Dass wir ständig präsent waren und aufgeklärt haben und das weiter tun, ist wichtig. Denn die Generation um Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski, mit denen er ja noch zusammengespielt hat, tritt langsam in den Hintergrund. Mittlerweile wird die Krankheit nicht mehr ausschließlich mit Robert, sondern mit anderen Leistungssportlern in Verbindung gebracht, die es erfolgreich geschafft haben, einen Ausweg zu finden.
SPOX: Wie reagieren denn junge Menschen, wenn Sie sie in der Stiftungsarbeit auf Robert ansprechen?
Enke: Die meisten mit 17 oder 18 Jahren kennen ihn schon noch, spätestens wenn ich dann frage. Letztens aber war ich in einer Schule, die sich mit dem Thema Depression auseinandersetzt und dort in der Mittelstufe wussten einige Jungs schon noch, wer Robert war, die Mädchen aber nicht. Es ist also noch nicht problematisch, aber wir müssen daran im Sinne der Stiftung natürlich arbeiten.
SPOX: Bei Ihrem ganzen Engagement zu sensibilisieren: Wie denken sie inzwischen über den Selbstmord von Robert?
Enke: Ich bin traurig darüber, dass es damals einfach noch nicht diese Möglichkeiten gab und kein Netzwerk, das uns helfen konnte. Damals war in den Köpfen noch nicht so verankert, was psychische Erkrankungen überhaupt sind. Klar gab es vereinzelt Mentaltrainer, aber nicht beim FC Barcelona, bei Benfica oder in Hannover. Das fing erst so allmählich unter Jürgen Klinsmann in der Nationalmannschaft an, da aber mit einem leistungssportlichen Ansatz und nicht mit der Intention, Depressionen zu behandeln. Es war einfach schwierig. Wir waren komplett allein auf weiter Flur und mussten autodidaktisch vorgehen und überlegen, wie wir Hilfe bekommen können.
SPOX: Wie sind Sie da vorgegangen?
Enke: Robert wollte unter keinen Umständen, dass es rauskommt. Also haben wir Krankheiten vorgeschoben. Das Versteckspiel, das er spielen musste, das auch ich spielen musste, ging natürlich an die Nerven, denn bis auf ganz enge Freunde wusste niemand von seiner Depression. Er war oft niedergeschlagen. Ich habe dann versucht, banal ausgedrückt, 'Quatsch' zu machen, damit es nicht so auffällt. Viele, auch meine Freunde, haben gedacht, er könne sie nicht leiden.
SPOX: Das klingt sehr schwierig.
Enke: Es war einfach ein unglaublicher Kampf, diese Krankheit geheim zu halten. Es ist immer noch schwierig, mit dieser Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen. Menschen bekommen an ihrem Arbeitsplatz gesagt: 'Komm, reiß dich zusammen', einfach weil Depressionen nicht so greifbar sind. Krebs zum Beispiel, der wird diagnostiziert, da hat man Blutwerte, sieht die Metastasen auf einem MRT. Bei einer Depression geht das nicht. Mich hat sehr erschüttert, was ich in einer Studie gelesen habe. Patienten, die Krebs und Depressionen hatten, haben darin angegeben, dass die Depression für sie schmerzhafter gewesen sei. Das erschüttert mich sehr, gerade weil ich erlebt habe, wie Robert gekämpft hat.
SPOX: Machen Sie sich trotzdem Vorwürfe, den Suizid nicht verhindert haben zu können oder machen Sie Robert Vorwürfe, sich das Leben genommen zu haben?
Enke: Nein, Vorwürfe gar nicht. Einen Punkt gibt es: Dass wir gemeinsam vielleicht seine Therapie auch in den guten Phasen hätten fortführen sollen. Dass ich da nicht gesagt habe: 'Komm, mach doch weiter'. Aber diese Zeiten genießt man dann umso mehr, denn während einer depressiven Phase war ich selbst auch manchmal wütend oder konnte einfach nicht mehr.
SPOX: Das ist mehr als nachvollziehbar.
Enke: Stell Dir vor, du hast Kinder und musst Angst haben, dass der andere sich etwas antut. Ich habe damit gelebt. Wir haben auch über Suizid gesprochen. Rückblickend bin ich erstaunt, ich hatte damals ja auch keine Ahnung von der Krankheit. Die erste Depression habe ich gar nicht als solche wahrgenommen. Aber: Alles was ich jetzt weiß, was andere Betroffene berichten, entspricht eins zu eins unserer Situation damals. Ich weiß, dass er gekämpft hat und sich nicht hängen ließ. Aber diese Krankheit kann tödlich enden, selbst wenn sie behandelt wird. Darüber muss man sich im Klaren sein und deshalb ist es wichtig, früh zu behandeln. Mir tut es einfach weh, dass er damals so leiden musste.