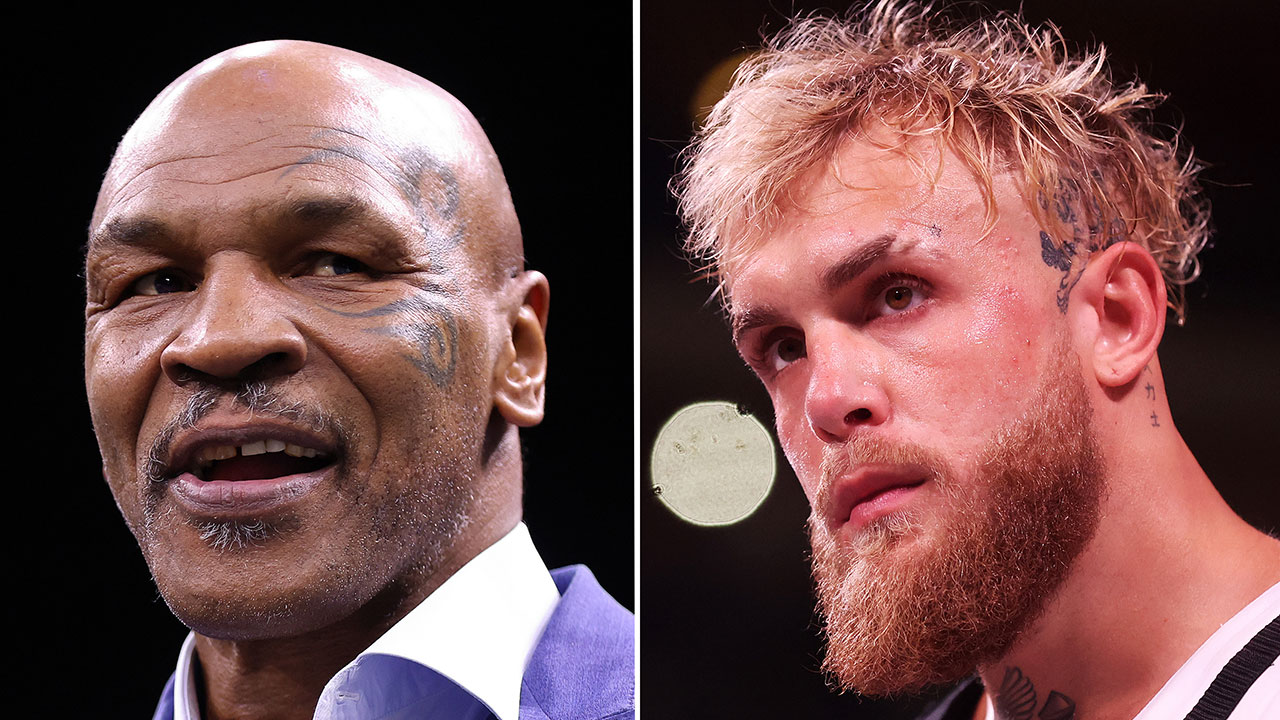Von Jörg Allmeroth aus London
Es kann sein, dass Angelique Kerber an diesem ärgerlichen Montag von Wimbledon für lange, lange Zeit zum letzten Mal als Nummer eins der Welt auf dem Platz stand. Wenn am nächsten Montag der Computer der Spielerinnen-Gewerkschaft WTA die neue Hackordnung ausspuckt, wird die Deutsche mindestens auf Platz 3 zurückfallen. Sie hat auch in den nächsten Monaten noch dicke Punktepolster zu verteidigen, als US-Open-Champion, als Finalistin der WM in Singapur.
Aber ist das Thema, das Kerber seit Monaten medial verfolgt, dieser Gipfel-Platz, der angebliche Druck als Anführerin ihres Sports, die Position als Gejagte in der Hitliste der Stars, überhaupt und wirklich noch ein Thema für Kerber? War es auch eins in Wimbledon, bei ihrem Versuch, sich ins Endspiel des wichtigsten Turniers der Welt vorzukämpfen?
Kerber scheint nicht nur in dieser Angelegenheit längst weiter zu sein als viele ihrer Beobachter aus Presse, Funk und Fernsehen. "Wichtig für mich ist, gutes Tennis zu spielen. Turniere zu gewinnen", sagte die 29-jährige aufs Neue nach ihrem frustrierenden Drei-Satz-Aus gegen die Spanierin Garbine Muguruza im Achtelfinale, "Nummer eins zu sein, das habe ich erlebt und genossen. Es zählt nicht mehr so." Oft ist ja auch einfach unklar, was man von Kerber erwartet: Eine energische Dominanz des Frauentennis, neue Siegesserien, Grand-Slam-Erfolge am laufenden Band?
Kerber hat längst mehr aus ihren Möglichkeiten gemacht, als sie selbst zu träumen gewagt hatte. Sie ist keine Steffi Graf, keine Serena Williams, keine Überfrau ihres Sports. Und doch schaffte sie 2016 eine Saison, die an das Wirken dieser Allerbesten erinnerte, mit zwei Grand Slam-Siegen, der olympischen Silbermedaille, dem Sprung auf Platz eins und mit dem Erreichen zweier weiterer großer Endspiele, in Wimbledon und bei der WM. Keine andere Spielerin außer Wuchtbrumme Williams schaffte Vergleichbares in der jüngeren Vergangenheit.
Fehlender Respekt
In Wimbledon sagte Martina Navratilova, sie finde die Kritik, die auf Kerber eingeprasselt sei, "absurd und kränkend": "Mir fehlt der Respekt für das, was sie geleistet hat. Und für die Arbeit, die sie investierte in ihr Tennis." Die Tennislegende hatte dabei auch im Blick, dass Kerber seit Jahren hartnäckig in der Weltspitze mitspielt, fast immer unter den Top Ten stand und auch schon vor den Coups der Vorsaison in den heißen Phasen vieler Top-Turniere mit in der Pokal-Verlosung war.
Kerber habe, das sagte der dreimalige Wimbledon-Champion Boris Becker in der BBC, "Deutschland wieder auf die Landkarte gebracht und die Fans stolz auf das Tennis blicken lassen. Sie muss gar nichts mehr gewinnen - und wäre trotzdem eine ganz Große.
Richtig ist: Kerbers erste Monate der Saison 2017 waren schwach, sie gewann kaum ein wichtiges Match, auch keins gegen die Spitzenspielerinnen. Na und. Dass dem strapaziösen Kraftakt bis tief in den letzten Spielzeit-Herbst hinein ein Durchhänger folgen würde, konnte nur die oberflächlichen Betrachter überraschen. Kerber litt keineswegs zuvorderst unter einem Nummer-Eins-Trauma oder den außersportlichen Belastungen, die der herausgehobene Platz mit sich bringt, sondern daran, dass die Saisonpause zu kurz war. Und der Körper sich nicht ausreichend regenerierte.
Paradox genug: Als sie nun, nach dem raschen Erstrunden-Aus in Paris, einen weiteren intensiven Trainingsblock einlegte und in Wimbledon so fit und drahtig wirkte wie 2016, spielte sie auch wieder wie eine Nummer eins - und verlor im besten Match des Jahres Platz eins. Es wirkte nicht wie eine dieser üblichen Phrasen in den Minuten nach einem Centre-Court-Einsatz, als Kerber sagte: "Ich fühle, dass ich wieder auf dem richtigen Weg bin." Der muss sie dann auch gar nicht auf Platz eins zurückführen, sondern nur zu gutem Tennis und vielleicht auch wieder kleineren und größeren Pokalcoups.
Unnötige Niederlage
Auch das Anspruchsdenken, das auf den zweiten enttäuschten Verlierer des Manic Monday zielt, auf Alexander Zverev, erscheint mitunter absurd. Den 23-jährigen Österreicher Dominic Thiem ausgenommen, ist Zverev im weltweiten Herrentennis mit seinen 20 Jahren der einzige Spieler aus der jungen Generation, der es schon wirklich mit den Topleuten aufnehmen kann. Sein Masters-Sieg in Rom kürzlich, der Vormarsch in die Top Ten waren Ausdruck der Fortschritte, die er schnell und konzentriert gemacht hat. Aber Zverev ist noch längst nicht ausgereift als Spieler, weder physisch noch psychisch.
Ihn stört das am meisten, er ist ungeduldig, er will weiter nach vorn, er sagte am Montag nach seiner komplett unnötigen Fünf-Satz-Niederlage Niederlage gegen den Kanadier Milos Raonic, er habe "keine Lust mehr zu lernen" und oft nur Komplimente für einen Auftritt zu erhalten.
Aber Zverev wird weiterlernen, genau so wie einst auch Federer, Nadal, Murray und Djokovic. Keiner von ihnen hat Wimbledon mit 20 gewonnen, diese Zeiten sind vorbei. Wenn Zverev sein großes Saisonziel erreicht, die Teilnahme an der ATP-WM in London, wäre es eine kleine Sensation. Denn dort spielen nur die acht Besten des Jahres, die Stabilsten und dauerhaft Guten. Es wäre der wirkliche Ritterschlag für den Hamburger.