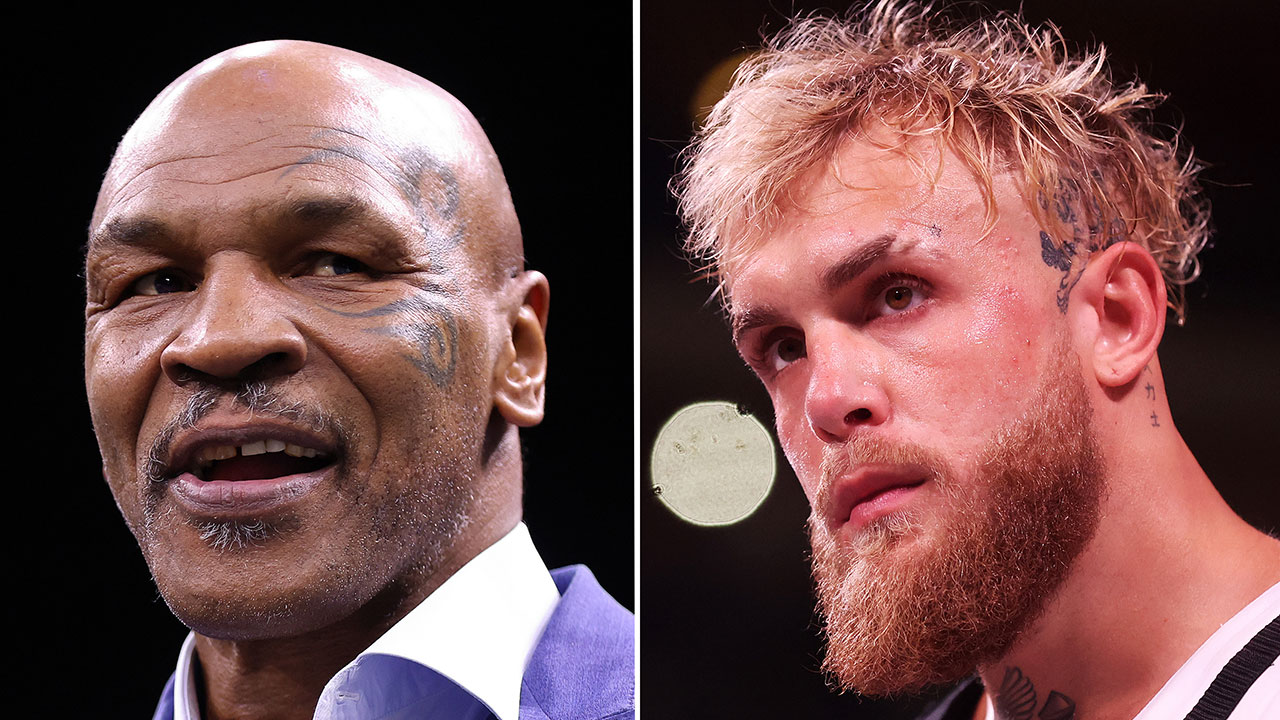Im Interview mit SPOX und Goal spricht Zöllner unter anderem über seinen Start beim BVB, Verhandlungen mit Schalke 04 im Jogginganzug, einen sauren Michael Zorc und den fluchenden Egozentriker Jürgen Klopp.
Herr Zöllner, außer ein paar alten Autogrammkarten und der Meldung, dass Sie Borussia Dortmund verlassen haben, findet sich im Internet nichts über Sie. Ist das hier trotz Ihrer fast 30 Jahre im Profifußball Ihr erstes Interview?
Frank Zöllner: In dieser Form auf jeden Fall. Als der BVB 2009 einen neuen Ausrüster bekam, drehten sie ein kleines Filmchen und da durfte ich auch mal etwas sagen. Das war's in der Hinsicht aber.
Dann haben wir nun einiges aufzuarbeiten. Sie haben 1990 im Alter von 22 Jahren in der Jugendabteilung des BVB als Physiotherapeut angefangen. Wie kam es und welche Verbindung hatten Sie zum Fußball?
Zöllner: Wenn man wie ich in Dortmund groß wird, ist man auch Borussia-Anhänger. Ich bin mit dem Fahrrad zur Südtribüne gefahren und habe früher selbst ein wenig im Verein gekickt. Meine berufliche Ausbildung begann 1986. Ich habe meine Praktika auf dem Weg zum Physiotherapeuten im Marienhospital in Dortmund absolviert. Dort arbeitete Dr. Falk Richter, der zugleich Vereinsarzt vom BVB war. Das war mir zu Beginn aber gar nicht klar. Zu den Praktika verholfen hat mir der dortige leitende Physiotherapeut, der wiederum eng mit dem damaligen BVB-Geschäftsführer Walter Maahs zusammengearbeitet hat. Maahs habe ich später selbst öfter behandelt.

Haben dann also Sie ihn oder er Sie gefragt?
Zöllner: Er meinte, es gäbe einen kleinen Engpass im Verein. Michael Zorc und Michael Schulz ließen sich ohnehin schon von Dr. Richter im Krankenhaus behandeln und so rutschte ich nach und nach in diese Geschichte hinein. Maahs sagte irgendwann, er wolle, dass ich nicht mehr im Krankenhaus, sondern für den Verein arbeiten solle. Allerdings nicht sofort bei den Profis, sondern innerhalb der Kooperation mit dem Reha-Zentrum Orthomed vor allem für die Jugendabteilung. So begann das, nebenbei war ich jedoch auch für die Profis abgestellt. Als ich 1991 Ottmar Hitzfeld nach seinem Kreuzbandriss behandelte, sagte er, er möchte mich künftig komplett bei der Mannschaft haben. Ab 1992 war ich dann dabei.
Wie stolz waren Sie, dass Sie von nun die Stars Ihres Herzensvereins behandelten?
Zöllner: Sehr, das war einfach geil. Vor allem auch, weil sich der Erfolg so schnell einstellte. 1992 wurde der BVB erst Vizemeister, dann stand man im UEFA-Cup-Finale, wenig später kamen die beiden Meisterschaften und der Champions-League-Sieg hinzu. Dortmund wurde mit der Zeit von einer riesigen Welle der Euphorie erfasst, die immer größer wurde und kein Ende zu nehmen schien. Damit hatte ja ein paar Jahre zuvor niemand gerechnet. Das hat einen als Mitarbeiter des Vereins schlichtweg mitgerissen, weil jeder nach diesen Erfolgen gierte.
1995 wurde der BVB erstmals nach 32 Jahren Meister, im Jahr darauf holte man die Schale erneut und 1997 die Champions League. Auch die Meisterschaft 2002 erlebten Sie mit. Was war für Sie am emotionalsten?
Zöllner: Es war alles sensationell. Für die Spieler war eher der Champions-League-Sieg das Größte, weil der BVB dadurch die beste Klubmannschaft Europas wurde. Ich fand die Meisterschaft 1995 aber deshalb so besonders, weil die beiden Stürmer Stephane Chapuisat und Karl-Heinz Riedle zum Saisonende mit Kreuzbandrissen ausfielen und der Titel mit dem sogenannten Baby-Sturm um Lars Ricken und Ibrahim Tanko geholt wurde. Als wir damals mit dem Truck durch Dortmund gefahren sind und die Begeisterung der 500.000 Menschen sahen, war das schlichtweg unglaublich.
Wie haben Sie im Gegensatz dazu die Zeit rund um die Beinahepleite 2005 wahrgenommen?
Zöllner: Ich hatte Angst um meinen Job. Ich werde diesen Tag nie vergessen, als die Molsiris-Anleger in Düsseldorf darüber entschieden, ob der BVB pleitegehen würde oder nicht. Als das zum Glück nicht eintrat, war man einfach nur glücklich. Und das, obwohl der Verein entschied, dass Spieler 20 Prozent und Mitarbeiter wie ich zehn Prozent ihres Jahresgehalts über mehrere Monate hinweg an den Verein zurückzahlen sollten, um eben die Kosten zu senken und das weitere Überleben zu garantieren. Damals hieß es noch, wenn es dem Verein finanziell wieder gutginge, bekäme man das Geld wieder zurück. Das war später nicht der Fall, aber es war einem egal, weil man sich mit Leib und Seele mit dem Verein und der Aufgabe identifizierte.
Wie groß war denn damals schon der Druck für einen Physiotherapeuten, einen verletzten Spieler fit zu bekommen?
Zöllner: Der Druck war immer da. Gerade in der Zeit, als es in Dortmund viele Trainer- und Ärztewechsel gab. Teilweise hatten wir vier, fünf Mannschaftsärzte in nur einer Saison. Mein Kollege Peter Kuhnt, mit dem ich fast ein eheähnliches Verhältnis hatte, und ich haben uns zum Glück ständig weitergebildet. Dadurch konnten wir unser Spektrum an Behandlungen für die Spieler derart erweitern, dass es zur damaligen Zeit schon ziemlich unkonventionell war. Man muss auch ehrlich sagen, dass wir uns beide sehr unter Druck gesetzt haben, um die verletzten Spieler so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu bekommen. Es ist bis heute immer eine persönliche Genugtuung, wenn der Spieler wieder einsatzfähig ist.
In den 1990er Jahren war das vielzitierte Team hinter dem Team noch deutlich kleiner als heute. Inwiefern hatten Sie Unterstützung?
Zöllner: Lange Zeit gar nicht, Peter und ich waren alleine. Die Arbeit im Kraftraum, das Athletiktraining, der Übergang von der Reha zu den ersten fußballerischen Übungen - für all dies waren wir zuständig. Peter meinte, ich hätte doch früher Fußball gespielt, also könne ich doch mit den Jungs, die aus der Reha kamen, auf den Platz gehen. Und dann stand ich da als ehemaliger Kreisliga-A-Spieler und habe einem Weltmeister wie Jürgen Kohler die Bälle zugeworfen. Wir hatten durch unsere Nationalspieler aber auch einen guten Kontakt zu DFB-Mannschaftsarzt Dr. Müller-Wohlfahrt hergestellt. Er hat uns beispielsweise noch am Vortag des Champions-League-Endspiels in München enorm geholfen. Wir hatten sechs angeschlagene Spieler. Also haben wir ihn angerufen, sind zu ihm in die Praxis gefahren und er knetete und spritzte dann mit.
Peter Kuhnt erzählte 2017 im SPOX-Interview, dass er Spieler auch im Urlaub zu betreuen hatte oder er sie zu Ärzten begleitete. War das bei Ihnen auch so?
Zöllner: Regelmäßig, vor allem bei Operationen. Wir hatten beide sozusagen unseren Spielerstamm, bei mir waren das zum Beispiel Leute wie Dede, Julio Cesar oder Jürgen Kohler. Einmal habe ich in meinem Urlaub einen Anruf von Michael Zorc bekommen, Alex Frei hatte sich das Innenband gerissen. Ich solle mit dem Auto nach Basel fahren, ihn dort vom Arzt abholen und anschließend nach Neuchatel düsen, um bei der OP dabei zu sein - und am nächsten Tag wieder zurück nach Dortmund. Wir haben da nie lange diskutiert, sondern es einfach gemacht, weil es gewissermaßen auch ein Privileg war. Für uns war es zudem wichtig, bei den OPs dabei sein zu können, weil wir so hautnah sahen, was wirklich wie gemacht wurde und nicht nur einen nüchternen OP-Bericht zugeschickt bekamen.
Kuhnt sagte auch, ihm sei sein eigener Stellenwert erst so richtig bewusst geworden, als er den BVB 2017 nach 23 Jahren verließ. Wie erging es Ihnen?
Zöllner: Das ist wahrscheinlich typbedingt. Für mich zeigte sich mein Stellenwert durch die ständigen Anfragen anderer Vereine, die ich mir meiner Meinung nach erarbeitet habe. Ich verhandelte zwischenzeitlich unter anderem mit Schalke. Ich empfand es auch als tolle Bestätigung, als mich Heiko Herrlich 2009 anrief und mich unbedingt nach Bochum holen wollte. Noch vor eineinhalb Jahren fragte Stefan Reuter an, ob ich nicht nach Augsburg kommen möchte. Ich sagte nur: "Du kennst doch die Antwort. Ich bin eine Ruhrpott-Pflanze, die den Staub und Dreck braucht. Mich kannst du nicht nach Augsburg packen." (lacht)